
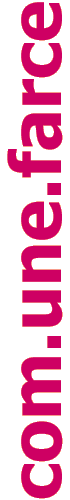 |
Franco 'Bifo' Berardi
gehört zu den Theoretikern des italienischen (Post-)operaismus. Er
wurde 1968 Mitglied der Gruppe 'Potere Operaio', deren heute bekanntester
Exponent wohl Toni Negri war. Bifo trennte sich von der Gruppe nach deren
leninistischer Wendung Anfang der 70er Jahre. In der Folge gründete er
mit anderen das Zeitschriftenkollektiv A/traverso und gehörte Mitte
der 70er Jahre zu den MacherInnen von Radio Alice in Bologna. Nach der
Niederschlagung der 77er Bewegung, in der die antagonistischen kulturellen
Konzepte jener Jahre ihren massivsten Ausdruck fanden, beteiligte er sich
zu Beginn der 80er Jahre an jener Analyse der kapitalistischen
Umstrukturierungsprozesse in (Nord)italien, die bis heute die materielle
Grundlage der Thesen der italienischen Postoperaisten bildet. Einen
wesentlichen theoretischen Bezugspunkt bildeten für sie die
Grundrisse-Fragmente von Karl Marx (Wir
haben diejenigen Stellen, auf die sich implizit auch der folgende Text
bezieht, nochmals hervorgekramt). Bifo gehört zu den Herausgebern der
Zeischriften- und Verlagsedition 'Derive Approdi' [übersetzt etwa:
'Deterritorialisierungen - Reterritorialisierungen', vgl.
Glossar].
Bifo wird auf Einladung von com.une.farce
vom 6. -13. Februar 1999 eine "Face-to-Face
Vortrags- und Diskussionsreise in Süddeutschland unternehmen
(Frankfurt, Stuttgart/Ludwigsburg, Reutlingen/Tübingen und
München). Der hier übersetzte Text stammt aus dem Jahr 1997 und
wurde zuerst in "EXIT - il nostro contributo
all'estinzione della civiltà" veröffentlicht. In der
nächsten com.une.farce (No.
2) soll ein Ausschnitt aus seinem Buch "Neuromagma"1
übersetzt werden.
Autonomes Zentrum
Marbach a.N.
In den letzten Jahren haben die
Worte "innovativ" und "konservativ" eine seltsame
semantische Umkehrung erfahren. Seit dem Zusammenbruch des
Staatskommunismus wird das Bündel von Werten und Perspektiven, die
sich mit seiner Geschichte verbinden, als konservativ etikettiert. Daran
ist etwas Wahres. Der Kommunismus stellte im guten wie im schlechten ein
radikales Transformationsprojekt innerhalb des Horizontes der
Industriegesellschaft dar. Und mit der Auflösung des industriellen
Modells und der Paradigmen, die die Arbeits- und Industriegesellschaft
konstituieren, schwindet auch die Kraft des Kommunismus, sowohl im Hinblick
auf Interpretation und Analyse als auch im Hinblick auf die Formulierung
eines politischen Projekts. Zugleich erscheint der hyperkapitalistische
Liberalismus als innovative Kraft. In einem gewissen Sinne ist auch das
richtig - insofern, als es der Liberalismus war, der die Prozesse der
Postindustrialisierung und Globalisierung beschleunigte. Und trotzdem liegt
in dem Ganzen ein begrifflicher und konzeptueller Mißbrauch.
Die beschleunigten Veränderungen (Auflösung der industriellen
Produktionszyklen, Zerlegung der Arbeitsformationen, Neuzusammensetzung
eines globalen Zyklus informatisierter Arbeit) führen dazu, daß
das epistemisch-praktische Paradigma des Kapitalismus immer dysfunktionaler
wird. Das Kapital hat sich zum Gesetz [Code] gemacht, das die Ökonomie
bestimmt [codiert], und die Ökonomie hat sich zum Gesetz gemacht, das
den Alltag, das Wissen und die Intelligenz neu bestimmt [codiert]. Diese
Art von Gesetzen wirkt in verkürzender, pathologischer Weise. Die
digitale technologische Innovation bringt ein Universum hervor, das nicht
gemäß dem quantitativen und auf Warenaustausch basierenden
mechanisch- industriellen Paradigma geregelt werden kann. Eben dort, wo der
Antrieb der Innovation liegt, im Zyklus der kreativen Produktion, verlieren
die Gesetze der Ökonomie ihre Bedeutung. Die unbegrenzte
Duplizierbarkeit der Produkte der menschlichen Intelligenz macht das
Konzept des Eigentums unbrauchbar. Das Immaterielle läßt sich
nicht zum Eigentum machen: wenn ich ein materielles Objekt benutze, kann es
niemand anderer benutzen; aber wenn ich ein immaterielles Gut gebrauche,
das ohne Kosten vervielfältigt werden kann, macht es keinerlei Sinn,
es als Eigentumsgegenstand zu betrachten. Je größer die
Produktivkraft der Arbeit ist, desto mehr Arbeitslosigkeit und Elend bringt
sie hervor: das ökonomische Gesetz wird widersinnig. Trotzdem setzt
die Ökonomie ihr Gesetz immer wieder von neuem durch. Je
unbegründeter ihr Herrschaftsanspruch ist, desto despotischer wird er
eingefordert.
Das
glücklichste Jahr
Das Editorial der Jahresausgabe
des Economist, 'The World of 1997', beginnt mit einer bestürzenden
Behauptung: "Das Jahr 1997 wird ein gutes Jahr werden, ein
außergewöhnlich gutes Jahr. Eine der vielen Segnungen: Es wird
Friede auf Erden sein." (...)
Der Economist hat seine Gründe anzunehmen, daß das Jahr 1997 ein
außerordentlich glückliches Jahr werde. Tatsächlich
können wir nach den Berechnungen der Buchhalter der angesehenen
Londoner Zeitschrift davon ausgehen, daß das Welt-
Bruttosozialprodukt um 4% wachsen wird. Halleluja.
Und was ist die Moral von der Geschichte? Natürlich gibt es eine Moral,
und die Moral ist einfach: Das Wohlergehen, der Frieden, das schlichte
Überleben der Menschheit stehen in entschiedenem, unumkehrbarem und
grundsätzlichem Widerspruch zum ökonomischen Modell des
Kapitalismus. Achtung: Jeder Priester des liberalen Glaubens wird Euch
erklären, daß die Dinge gerade andersherum liegen. Das
heißt: wenn sich die Leute in Algerien niedermetzeln und die
Lebenserwartung in Rußland sinkt, liegt das gerade daran, daß
die Regeln des Kapitalismus noch nicht in reinster Form angewendet werden,
so wie es die Professoren von Chicago lehren. Oh yes. Aber die Professoren
von Chicago erzählen ein fanatisches Märchen: Sie erfinden einen
Ort, einfach und rein, genannt der Markt. Wenn erst jedes Element der
Differenzierung ausgemerzt ist, wenn alle Menschen (theoretisch) in
statistisch erfaßbare Größen umgewandelt worden sind, wird
die unsichtbare Hand von Adam Smith in Vollkommenheit zu wirken beginnen
und in der Selbstregulierung der unzählbaren ökonomischen
Egoismen wird sich so, in magischer Weise, das Beste für die
Menschheit verwirklichen. "Aber eine derart reine Gesellschaft
existiert nicht, und der Ausgleich der oekonomischen Egoismen vollzieht
sich heute eher in Form einer unaufhaltsamen Ausweitung von dem, was
gemeinhin mit Kriminalitaet, Korruption und Gewalt bezeichnet wird.
Auf diese Weise produziert ein Maximum an Liberalismus ein Maximum an
Unfreiheit für die größte Zahl, wenn nicht für alle
ökonomischen Akteure, auch für die starken unter ihnen. Deswegen
kann Immanuel Wallerstein in seinem neuesten Buch 'After Liberalism'2
behaupten, daß, ungeachtet des Scheins, der Liberalismus auf diesem
Planeten tot ist. Allerdings droht sein Kadaver den Planeten selbst
verwesen zu lassen und mit ihm seine Bewohner.
Nun die Theoretiker der Globalisierung. Diese versprechen eine leuchtende
Zukunft, wenn schon nicht für alle (man kann nicht das Unmögliche
wollen) dann doch für einen Teil, sagen wir für 5-10% der
Menschheit. Die Theoretiker der Globalisierung und der Excellence (einen
schwachsinnigeren und zynischeren Ausdruck konnten sie nicht finden)
skizzieren eine Welt, in der eine Minderheit von Übermenschen [dt. im
Original], auf ewig miteinander verbunden in einem planetarischen Netzwerk
der Entscheidungsträger und Manager, in rationaler Weise das regiert,
was sich auf dem Planeten noch regieren läßt: Die Finanzen, die
Leitlinien der grundlegenden technologischen Innovation, die Schnittstellen
zwischen ökonomischer Macht und technisch-kommunikativem Netz.
Rosabeth Moss Kanter behauptet in einem widerlichen Buch mit dem Titel
'World Class', daß die Welt der Zukunft den Kosmopoliten gehöre.3
Wer soll das sein?
"Die Kosmopoliten sind reich an drei unantastbaren Gütern, den
drei 'C', die in einer globalen Ökonomie Vorherrschaft und Macht
begründen: Concepts - das überlegene Wissen und die neuesten
Ideen, Competence - die Fähigkeit, an jedem Ort auf höchstem
Niveau zu agieren, Connections - die besten Beziehungen, die Zugang zu den
Ressourcen der anderen und den Organisationen in aller Welt verschaffen.
Dank der Tatsache, daß die Kosmopoliten die besten und neuesten
Konzepte liefern, ein Höchstmaß an Kompetenz besitzen und
hervorragende Verbindungen haben, erringen sie Einfluß auf die
Personen vor Ort."
Welch brillante Ideen, wenn auch ein bißchen à la Hitler. Wie
könnte man übersehen, daß die Theorie der Excellence eine
(zugegebenermaßen etwas schwache) Neuauflage des nazistischen
Übermenschentums ist (das nichts mit dem sublimen Desinteresse
Nietzsches zu tun hat)? Vorsicht: ich möchte keinesfalls behaupten,
daß Rosabeth Moss Kanter, wie abstoßend ihre Ideen auch sein
mögen, etwas Unsinniges sagt. Ganz im Gegenteil: Die Kosmopoliten, von
denen sie spricht, existieren wirklich. Sie sind die Verbindungsstellen der
Automatismen, die der planetarische biomechanische Superorganismus zu
entwickeln im Begriff ist, seit der Prozeß der Digitalisierung
begonnen hat, die Macht in eine virtuelle Dimension zu verlagern und
Schnittstellen der techno- sozialen und techno- linguistischen Kontrolle
einzurichten.
Mondialisierung
und Globalisierung
Einige, darunter Paul Hirst und
Grahame Thompson, haben neuerdings die Theorien der Globalisierung vom
Standpunkt der klassischen Ökonomie aus kritisiert: "Die
Globalisierung ist ein akzeptabler Mythos für eine Welt ohne
Illusionen, aber sie ist ein Mythos, der uns jeder Hoffnung beraubt."4
Dieses Buch legt mit Hilfe einer beeindruckenden und wohlorganisierten
Menge von Daten dar, daß man von Globalisierung nicht als einem neuen
Phänomen sprechen kann und daß ihre Bedeutung übertrieben
worden ist. Die Warenflüsse waren im Gegenteil in der geschichtlichen
Periode zwischen 1870 und 1914 stärker integriert als heute. Aber die
Argumentation von Hirst und Thompson verliert den zentralen Aspekt der
Globalisierung aus dem Blickfeld. Dieser Aspekt betrifft weder die
Integration des Marktes noch die Zusammensetzung des Kapitals, aber
wesentlich die Zusammensetzung der gesellschaftlichen Arbeit. Der Kern des
Problems ist nicht die Entstehung multinationaler Unternehmen oder die
Geldzirkulation. Der Kern des Problems ist die molekulare Veränderung
der menschlichen Arbeit und der weltweiten produktiven Interaktion.
Die semiotische Arbeit (die Arbeit an/mit Zeichen) stellt zugleich die
umfassende Form und das verflüssigende Element des neuen, weltweiten
Produktionssystems dar. Diese Arbeit ist deterritorialisiert, die Form des
Netzes wird zur umfassenden Form, in der sich die gesellschaftliche Arbeit
auf planetarer Ebene neu zusammensetzt. In der Vergangenheit sprachen wir
von internationaler Arbeitsteilung, aber heute hat dieser Ausdruck keine
Bedeutung mehr. Vielmehr sind wir Zeugen eine Art von Integration
deterritorialisierter und beweglicher Fragmente von Arbeit durch eine
netzartige Maschinerie. Immer häufiger stellt sich Arbeit juristisch
als unabhängige, unternehmerische Arbeit dar. Aber tatsächlich ist
die mentale Arbeit in jeder Hinsicht abhängige Arbeit, weil sie von dem
Netz, von den Verbindungen abhängig ist. Und genau dies entgeht einem
rein ökonomischen Ansatz, weil sich die mentale Arbeit nur schwerlich
auf die Kategorien der ökonomischen Analyse reduzieren läßt.
Das, wovon Hirst und Thompson sprechen, ist ein altes Phänomen, das
dem Kapitalismus seit dem 16. Jahrhundert wohlbekannt ist: der Weltmarkt,
die Mondialisierung der Märkte. Was ist der Unterschied zwischen
Mondialisierung und Globalisierung? Die beiden Begriffe bezeichnen nicht
die gleiche Sache, den gleichen Vorgang.
Der Prozeß der Mondialisierung definiert sich durch einen wachsenden
Warenaustausch zwischen verschiedenen Zonen des Planeten, durch eine
zunehmende Integration der Märkte und infolgedessen der Lebensstile,
die mit dem Konsum verknüpft sind. Steigende Anteile des
Bruttosozialprodukts der produzierenden Länder werden in
geographischen Regionen konsumiert, die weit vom Ort der Produktion
entfernt liegen. Der Prozeß der Globalisierung bringt [dagegen] eine
Integration der Produktionszyklen mit sich. Steigende Anteile der
Produktion sind das Ergebnis einer weltweiten Montagekette, einer
horizontalen Integration zwischen verschiedenen Momenten des
Arbeitsprozesses (Projektierung, Herstellung der Halbfertigprodukte,
Montage und Endkontrolle, Design, Vermarktung), die sich in verschiedenen
Gebieten der Erde abspielen. Während der Prozeß der
Mondialisierung die Mobilität der fertigen Produkte bedeutet, meint
der Prozeß der Globalisierung eine wirkliche und tatsächliche
Deterritorialisierung des Produktionsprozesses.
In der Phase, die wir als Globalisierung definieren, besteht zwischen
finanzieller Investition und der Kontrolle über die Produktion kein
Zusammenhang mehr. Wer sein Kapital investiert, ist am Geschäftserfolg
des Unternehmens interessiert, in das er investiert hat, aber er muß
nicht einmal wissen, welche Waren dieses Unternehmen produziert. Die
Trennung zwischen Tauschwert und Gebrauchswert ist endgültig. Die
Zirkulation des Werts ist völlig losgelöst von der materiellen
Zirkulation der produzierten Güter. Das Gut, das gehandelt wird, ist
immer häufiger nichts als Information.
Es ist offensichtlich, daß dieser Übergang, den wir
Globalisierung nennen, erst durch die Verbreitung von Kommunikations- und
Virtualisierungstechnologien möglich wurde: Der
Produktionsprozeß ist zu einem guten Teil immaterialisiert, was
produziert wird, sind also Informationen. Im allgemeinen sind die
Produktionssektoren, in denen materielle Gegenstände in klassisch
industrieller Weise durch physische Energien bearbeitet werden müssen,
in den Randgebieten des internationalen ökonomischen Systems
angesiedelt, dort, wo Handarbeit zu niedrigen Kosten zur Verfügung
steht.
Dieser Prozeß, der sich heute voll entfaltet, wurde von Felix
Guattari 1981 in einem Essay mit dem Titel 'Der weltweit integrierte
Kapitalismus'5 auf den Punkt gebracht. Nach einer Analyse des reinen
Simulationscharakters des Kalten Krieges zeigt Guattari die grundlegende
geopolitische und ökonomische Integration der beiden Blöcke auf.
Der Ausgangspunkt der Analyse Guattaris erschließt sich aus den
ersten Worten des Buches: "Das Kapital ist keine abstrakte Kategorie,
sondern ein semiotischer Operator."
Was heißt das? Während sich der Arbeitsprozeß durch
Deterritorialisierungen aller Art fragmentiert, ausdehnt, auflöst und
wieder neu zusammensetzt, integriert der Prozeß der Verwertung all
die Fragmente der kapitalistischen Produktion, und zwar nicht nur (nicht
mehr nur) durch das abstrakte Wirken des Wertgesetzes, sondern durch die
konkrete und direkte Wirkung der Technologien, die es ermöglichen,
Informationen ohne Zeitverzögerung zu transportieren. "In der
marxistischen Theorie ist es der abstrakte Wert, der die Gesamtheit der
menschlichen Arbeit über-codiert, sofern sie der konkreten Produktion
von Tauschwerten dient. Aber die aktuelle Veränderung des Kapitalismus
tendiert dahin, daß alle Gebrauchswerte zu Tauschwerten werden und
alle produktive Arbeit von der Maschinerie abhängig wird. Der
Warentausch selbst hat sich auf die Ebene der Maschinerie verlagert, seit
die Rechner über Kontinente hinweg kommunizieren und den Managern die
Handelsklauseln diktieren. Die automatisierte und informatisierte Produktion
erhält ihre Konsistenz nicht mehr von einer menschlichen Grundlage,
sondern aus der Kontinuität der Maschinerie, die alle menschlichen
Funktionen und Aktivitäten durchdringt, umschließt, zerlegt,
miniaturisiert und verwertet."
Wenn Guattari sagt, daß das Kapital ein semiotischer Operator sei,
heißt das also, daß die Durchdringungskraft des kapitalistischen
Modells nicht mehr nur von einem Effekt abstrakter Über-Codierung
abhängt, der sich im Moment des Warentauschs manifestiert.
Ebenso hängt sie von der technologisch vermittelten Integration der
unterschiedlichen Momente der Warenproduktion ab, von der Projektierung bis
hin zu den technowissenschaftlichen, informationellen, materiellen Aspekten
des Produktionsprozesses, usw. Guattari läßt sich nicht im
geringsten durch das Spiel der Simulationen ablenken, das zu Beginn der
Achtziger auf der Welt-Bühne aufgeführt wurde, sondern deutet
direkt auf die langfristige Entwicklungslinie und nimmt so den Prozeß
vorweg, der sich in den Neunzigern vor unseren Augen entfaltet:
a.) Durchsetzung (oder vielmehr Innervation, Durchdringen, invasive
Wucherung) des kapitalistischen Modells, verstanden als semiotischer
Operator, als Regel für eine verallgemeinerte Trans-Kodifizierung.
b.) Überhandnehmen der Ränder, einerseits in Form von
Überbleibseln, Wiedergängern, Reterritorialisierungen
(Identitätsobsessionen, Nationalismen, Fundamentalismen und
Tribalismen), andererseits in Form von Minoritäten, Autonomien,
Deterritorialisierungen (Subkulturen, provisorische Gemeinschaften,
Kontaminierungen der [herrschenden] Kultur).
Verkabelung des
menschlichen Schicksals und Kommunitarismus der Zukunft
Die Globalisierung ist Folge
einer Integration von Technologie, Semiose und Ökonomie. Dank der
elektronischen Technologien kann die Ökonomie die semiotische
Aktivität integrieren und überkodieren. Die Globalisierung
erscheint als Faktor, der eine Verkabelung des kollektiven menschlichen
Schicksals bewirkt. Es gibt keine Möglichkeit mehr, die Zustände
lokal zu verändern, weil die Grundgrößen der sozialen
Wirklichkeit durch das komplexe Spiel globaler Wechselwirkungen bestimmt
sind, die sich als immer unabhängiger vom politischen Willen erweisen.
Der Diskurs der Apologeten der Globalisierung ist zugleich unmenschlich in
ethischer und kümmerlich in konzeptueller Hinsicht. Sie sagen, man
könne sich der Globalisierung nicht widersetzen, weil diese ein
intrinsischer Effekt der neuen Technologien sei (was unbestreitbar ist),
und daß man man sich folglich auch den sozialen Konsequenzen nicht
widersetzen könne, die dieser Prozeß mit sich bringt. Die
Grenzen dieser Sichtweise liegen darin, daß es ihr nicht gelingt,
sich die Möglichkeit vorzustellen, daß ein neues Paradigma auf
der Bildfläche erscheinen könnte, ein Paradigma, das sich nicht
mehr auf den Warentausch reduzieren läßt.
In den letzten zwei Jahren hat in Süd-Korea eine Reihe von
Arbeiterkämpfen den lange bestehenden Unterwerfungspakt des neuen
ostasiatischen Proletariats zerbrochen. Wahrscheinlich werden in den
kommenden Jahren in den anderen Ländern Kämpfe ausbrechen, auch
in China, das bereits jetzt von ethnischen und sozialen Konflikten
erschüttert wird. Aber das wird keine Krise des Globalisierungsmodells
herbeiführen, im Gegenteil wird es den Prozeß der Globalisierung,
der Mentalisierung und der Verkabelung menschlicher Aktivität
beschleunigen.
Wir verfügen über kein Modell, um uns vorzustellen, entlang
welcher Linien der Prozeß der sozialen Neuzusammensetzung der mental
gewordenen Arbeit ablaufen wird. Zu diesem Zweck [der Re-Organisation der
‘mentalisierten’ Arbeit als sozialer Kraft, d.Ü.] taugt weder das
gewerkschaftliche Modell (Verhandlungen über den Preis und die Dauer
der geliehenen Arbeit), noch das politische Modell eines Kampfs um die
Veränderung der Formen [politischer] Repräsentation. Sowohl das
eine wie das andere sind alte Rüstungen, die im Kampf gegen die
Herrschaft des industriellen Kapitalismus nützlich waren. Aber jetzt
sind solche Waffen stumpf geworden. Gewerkschaftliche Verhandlungen sind
eine stumpfe Waffe, weil das Verhältnis zwischen abhängiger
Arbeit und Kapital vollkommen abstrakt, beweglich, jederzeit fragmentierbar
und neu zusammensetzbar geworden ist. Im Zyklus der mentalen Arbeit gibt es
keine Arbeiter mehr, sondern lediglich Fragmente verfügbarer Arbeit.
Das Quantum der Arbeitszeit, von dem Marx sprach, war eine Abstraktion. Die
Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus hat sich zur Aufgabe gemacht, die
Abstraktion zur Konkretion zu führen, wie es häufig mit Konzepten
von Marx geschieht. Heute hat sich diese Abstraktion materialisiert, denn
das weltweite computerisierte System kann Fragmente abhängiger
menschlicher Zeit zusammensetzen, die an verschiedenen Orten des Planeten
erbracht werden, unter unterschiedlichen Bedingungen und in [sozialen]
Kontexten, die nichts voneinander wissen. Der einzige Kommunikationskanal
zwischen den diversen Fragmenten der atomisierten planetaren Arbeit besteht
in der computerisierten Maschinerie, die sie zusammensetzt.
Und noch stumpfer ist die Waffe des politischen Kampfes, des Wechsels der
politischen Vertretung, seitdem die politischen Vertreter ungeachtet ihrer
hysterischen Entscheidungsfreude überhaupt nichts mehr regieren, weil
die politische Repräsentanz durch technosoziale und technolinguistische
Schnittstellen ersetzt wird, die in der Lage sind, die sozialen Beziehungen
wirksam in ihrer materiellen Zusammensetzung zu gestalten. In diesem Sinn
können wir sagen, daß die Unterscheidung zwischen rechts und
links keine Bedeutung mehr hat; denn die politische Klasse entscheidet
nicht über die Richtung, in der die Gesellschaft geht, sondern sie
beschränkt sich darauf, die Anweisungen zu ratifizieren, die der
Gesellschaft von den techno-sozialen und techno-linguistischen Automatismen
auferlegt werden.
Die Globalisierung ist Ergebnis eines Integrationsprozesses zwischen
Technologie und Semiose. Der semiotische Prozeß, der Austausch der
Zeichen, der sich ununterbrochen zwischen bewußten Organismen
abspielt, wird zunehmend von Automatismen beherrscht, die sich in den
techno- sozialen und techno- linguistischen Schnittstellen bestimmen. In
diesem Sinne können wir sagen, daß die Globalisierung eine
Verkabelung des menschlichen Schicksals bedeutet, die Codierung dieses
Schicksals in der Sprache der kapitalistischen Ökonomie.
Die Apologeten der Globalisierung sind obszön und dumm, aber die
Globalisierung als solche ist alles andere als das. Dumm allerdings sind
auch die, die den Widerstand gegen die Globalisierung so predigen, als
wäre es möglich, lokalistische Nischen zu verteidigen, oder als
ob eine fundamentalistische und traditionalistische Reaktion
wünschenswert wäre gegen die kulturelle Homogenisierung, die die
Globalisierung mit sich bringt.
Die Globalisierung ist der Horizont, vor dem sich die Modi des
kommunikativen Handelns neu definieren. Jenseits des Horizonts der
Globalisierung können wir uns Abspaltungen autonomer Kolonien
rebellierender Kosmopoliten vorstellen, das Zusammenfließen lokaler
Arbeiterkämpfe und Rebellionen der Empfindsamkeit und Intelligenz der
Arbeiter der Hohen Technologien.
Das ist der Kommunitarismus, den wir brauchen: die Bildung von Kommunen
telematischer Piraten, subliminaler Saboteure, von Gelehrten, die
fähig sind, sich von der existierenden Welt zu lösen, die dazu in
der Lage sind, neu sprießende und sezessionistische Welten
hervorzubringen. Massenhafte Desertion von den Gesetzen, der Arbeit, den
Kriegen, den Zugehörigkeiten, vom Gehorsam und von der Verantwortung.
Das ist der Kommunitarismus, der kommen wird.
Franco
"Bifo" Berardi
Übersetzt vom Autonomen Zentrum Marbach a.N.
Anmerkungen:
1Berardi, Franco: Neuromagma. Lavoro
cognitivo e infoproduzione. Rom 1995 (Castelvecchi).<zurück zum Text>
2Wallerstein, Immanuel: After liberalism. New
York 1995 (New Press).<zurück zum Text>
3Inzwischen auf deutsch erschienen: Kanter,
Rosabeth Moss: Weltklasse. Im globalen Wettbewerb lokal triumphieren. 1996
(Ueberreuter Wirtschaftsverlag).<zurück zum Text>
4Hirst, Paul/Thompson, Grahame: Globalization
in question. The international economy and the possibilities of governance.
Cambridge/Oxford 1996 (Polity Press).<zurück zum Text>
5Guattari, Felix: Il capitalismo monidiale
integrato. Verona 1997 (edizione Ombre Corti).<zurück zum Text>
Kleines
Wörterbuch für den angewandten Post-Operaisten
Ein P a r a d i g m a
ist ein Beispiel, das eine umfassende Tendenz zum Ausdruck bringt.
D e t e r r i t o r i a l i s i e r u n g meint, abstrakt
gesprochen, Ablösung einer Struktur von einem festen Ort im
geographischen, sozialen, kulturellen und/oder politischen Raum. In den
achtziger Jahren wurde der Begriff häufig im Kontext der subversiven
Mikropolitiken benutzt. (Heute artikuliert beispielsweise Hakim Bey in
"Temporäre Autonome Zonen" die Vorstellung einer
deterritorialisierten, nomadischen Gegenmacht). Dies impliziert die
Vorstellung, daß "die Macht" an festen (strategische) Orte
gebunden ist und durch bewegliche (taktische) Nadelstiche ins Wanken
gebracht werden kann. Aber wie wir mittlerweile wissen, kann sich auch
"die" Macht/"das" Kapital deterritorialisieren. Der
umgekehrte Prozeß der R e t e r r i t o r i a l i s i e r u n g meint entsprechend die (Wieder-) Herstellung fester
Zuordnungen, sozialer, kultureller, regionaler Beziehungen.
S e m i o t i k ist die Lehre von den Zeichen und S e m i o s e
ist der Prozeß, durch den Zeichen mit Bedeutung und Inhalt versehen
werden.
M e n t a l e A r b e i t ist geistige und immaterielle
Arbeit, abhängiger und subalterner Output von Kreativität im
Kontext einer kapitalistisch organsierten Produktion.
S o z i a l e A r b e i t meint nicht Sozialarbeit,
sondern diffuse, im sozialen Raum deterritorialisierte Arbeit: Die
produktive Arbeit wird nicht an einem abgrenzbaren, festen Ort (in der
Fabrik) und zu festen Zeiten erbracht, sondern an unterschiedlichen Orten
und verwoben mit anderen sozialen Aktivitäten. Eine
t e c h n o - s o z i a l e S c h n i t t s t e l l e
kann
sowohl eine Kontroll- oder Überwachungstechnologie sein, eine
Organisation, ein technisches Gerät oder ein Individuum, das soziale
Prozesse mit technischen Mitteln regelt oder kontrolliert. Hierzu
gehören Software und Hardware, die verhindern sollen, daß
Minderjährige bestimmte Inhalte zu Gesicht bekommen, oder auch der
freundliche Bulle hinter dem Videomonitor, der die Hausordnung in
bundesdeutschen Bahnhöfen durchsetzen hilft. Auf höherer Ebene:
der Spine Doctor, der nach statistischer Analyse der jeweils angesagten
Blubberwörter Schröders Rede schreibt, oder der Analytiker, der
ausrechnet, daß der Unternehmensstandort XY jetzt doch besser
geschlossen wird. Eine t e c h n o - l i n g u i s t i s c h e S c h n i t t s t e l l e ist
beispielsweise ein Journalist, der in einer bestimmten sozialen Situation
einen gespeicherten Text aufruft, bearbeitet und anpasst, und ihn
anschließend wieder in technisches (Massenkommunikations-) Medium
einspeist. (Insofern ist der/die SchreiberIn dieser Zeilen eine
technolinguistische Schnittstelle mit niedriger
Übertragungskapazität (2.7 bps) ;-)
|