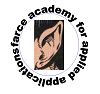
no.4 inhalt
Informationen
Kostenloses
Erststudium
HRZ
Careering
Uni-Shop
Unsere Sponsoren
Farce Academy for Applied Applications: Das, was durchs Netz
rutscht,
Studium Generale![]()
![]()
Thomas Berker
Von Kalifornien nach Darmstadt.
Immaterielle
Arbeit und der Informationsraum
wird durch dieses gefiltert.
Theodor W. Adorno
Derartige demographische
Ungereimtheiten verweisen auf gesellschaftliche Verhältnisse, Widersprüche
und Antagonismen. Ausgehend von Richard Barbrooks und Andy Camerons
Beschreibung der frühen Internetnutzendenschaft, in Abgrenzung von Toni
Negris und Maurizio Lazzaratos Verallgemeinerung dieses Typus und mich
schließlich an die Thesen der Darmstädter AG KAIROS anlehnend, werde ich
im folgenden eben jenen sich mit dem Internet verbindenden
gesellschaftlichen Friktionen nachspüren.
1. Kalifornische
Ideologie
Als Träger einer bis heute
virulenten, eng mit dem Internet verbundenen Ideologie, machen Richard
Barbrook und Andy Cameron (1997) eine eine soziale Gruppe aus, die
zugleich in der Frühzeit des Netzes einen wichtigen Teil der aktiven und
gestaltenden Nutzendenschaft bildet.
Kern dieser „kalifornischen
Ideologie” sei der Glaube „an das emanzipatorische Potential der neuen
Informationstechnologien” (ebd., 15), er „entwickelte sich aus einer
seltsamen Verschmelzung der kulturellen Boheme aus San Francisco mit den
High-Tech-Industrien des Silicon Valley.” (ebd.)
Barbrook/Cameron
gehen also zurück in die 60er Jahre, als „die Radikalen der Bay Area die
Pioniere der politischen Einstellungen und des kulturellen Stils der neuen
linken Bewegungen in der ganzen Welt” (ebd., 17) gewesen seien. Zwar habe
ein Teil dieser „Hippies” explizit technikfeindlich agiert, ein anderer
Teil von „kommunitär orientierten Medienaktivisten” (ebd., 18) habe sich
jedoch „großzügig von den High-Tech- und Medienindustrien gefördert”
(ebd.) als „personelle[r] Kern der Medien-, Computer- und
Telekommunikationsindustrien” (ebd.) etablieren können. So sei schließlich
gelungen, den „freischwebenden Geist der Hippies mit dem unternehmerischen
Antrieb der Yuppies” (ebd., 15) zu vereinen. Kreativitäts- und
Demokratieideale der „Hippies” und der Bedarf der einschlägigen Industrien
nach den Menschen, „die Originalprodukte entwickeln und erzeugen können –
von Softwareprogrammen und Computerchips bis hin zu Büchern und
Fernsehprogrammen” (ebd., 18) – hätten zu einem neuen Beschäftigungstypus
geführt. Diese neue „Arbeiteraristokratie” (ebd.) habe z.T. sehr gut
bezahlt, mit großer Autonomie und häufig nur durch Zeitverträge gebunden
gearbeitet (vgl. ebd.,19).
Der ‘ursprüngliche Geist des Internet’,
dessen Stilisierung als Gemeingut gelten kann (vgl. Hanke/Becker 1998),
erweist sich so schon in nuce als gar nicht so gegensätzlich zum ‘global
capitalism’. Barbrook und Cameron rücken das Dreieck zwischen Staat,
Internetpionieren und High-Tech-Industrien zurecht:
„Die staatliche
Subventionierung und das Engagement der Szene [der Alternativen der
Westküste, TB] übte einen enormen, wenn auch nicht anerkannten und nicht
berechenbaren positiven Einfluß auf die Entwicklung von Silicon Valley und
anderen High-Tech-Industrien aus.” (Barbrook/Cameron 1997, 23)
Der
Einfluß der Lage, der Normen und der Lebensformen der Alternativen ist
eben auch in den beschriebenen neuen Formen der Arbeitsorganisation zu
finden, die sich in Abgrenzung und Widerstand zu klassisch fordistischen
Arbeitsweisen entwickelt haben, sie können nach Barbrook/Cameron als
postfordistische gefaßt werden (vgl. ebd., Anm. 11).
2. „Immaterielle
Arbeit” – Ein Kalifornischer Typus?
Die Beschreibung dieser
frühen Internenetnutzenden ist keineswegs von lediglich historischem
Interesse. Einige ihrer Eigenschaften sind sogar wiederholt als Maß der
Dinge einer zukünftigen Gesellschaft beschrieben worden.
Seit den 70er
Jahren mehren sich Stimmen, die immer irgendwie verbunden mit der neuen
Technologie der Computer eben diesen alle Bereiche der Gesellschaft
ergreifenden Wechsel vom Alten hin zum Neuen prognostizieren.
Im
folgenden beziehe ich mich auf Vertreter dieses Feldes, auf die Thesen der
„Postoperaisten” Toni Negri und Maurizio Lazzarato. Diese beschreiben am
konsequentesten den Typus eines (zukünftigen) Arrangements von Arbeit und
Leben, das mit neuen Mediennutzungsformen unentwirrbar verbunden ist. Der
Bezug auf Barbrooks/Camerons Träger der Kalifornischen Ideologie, die
frühen Internetnutzenden, ist dabei besonders leicht herzustellen.
Letztlich stilisieren Negri und Lazzarato, ohne explizit bezug zu nehmen,
die historisch geographisch zu verortende Gruppe, die die beiden
englischen Soziologen beschrieben haben, zum Typus und konstatieren dessen
Verallgemeinerung.
Nach eigenen Angaben zurückgreifend auf
großangelegte Untersuchungen über die Arbeiterschaft im Großraum Paris,
aber auch auf die eigene politische Erfahrung im Italien der 70er Jahre
(vgl. Negri 1996b, 93) entwerfen sie den Typus der mentalen (Negri) bzw.
immateriellen (Lazzarato) Arbeit und der darauf bezogenen Arbeitenden.
Folgen wir zunächst der Beschreibung des Typus bei Lazzarato (1998).
In
der immateriellen Arbeit seien alle Charakteristika ‘postindustrieller’
Ökonomie ‘verdichtet’. Taylorismus, Massenproduktion und -konsum, kurzum
alle zentralen Bestandteile des Fordismus markieren den maximalen Abstand
zu der von Lazzarato skizzierten immateriellen Arbeit. Ursprünglich
verortet sei diese vor allem in den Bereichen der „audiovisuellen
Industrien, der Werbung und des Marketing, der Mode, der Computersoftware,
der Fotografie, künstlerisch-kultureller Betätigung im allgemeinen etc.”
(Lazzarato 1998, 46). Hier sind zweifellos auch Barbrooks und Camerons
Internetpioniere gemeint, Lazzarato fährt in seiner Beschreibung der
immateriellen Produktion ganz in deren Sinne fort:
„Tätigkeiten dieser
Art […] sind das Ergebnis eines synthetisierenden Know-how: Dieses
kombiniert intellektuelle Fähigkeiten, die sich als kultureller und
informationeller Gehalt niederschlagen, mit handwerklichem Geschick, das
Kreativität, Imagination, technische Kenntnisse und manuelle Fertigkeiten
zusammenfügt; schließlich schließt es die Fähigkeit ein, unternehmerische
Entscheidungen zu treffen […].” (ebd.)
Doch es gibt weitere Parallelen
zwischen der historischen Rekonstruktion der sozialen Gruppe der frühen
Internetnutzenden und dem Typus der immateriellen Arbeit. Wir haben von
Barbrook/Cameron bereits erfahren, daß Arbeit dieser Art mit besonderen
Formen der Arbeitsorganisation verbunden ist, in den Worten Lazzaratos
sind das: „Prekäre Beschäftigung, Hyperausbeutung, hohe Mobilität und
hierarchische Abhängigkeiten […]” (ebd., 47). Er führt dies auf die
spezifische vorherrschende Organisationsform immaterieller Arbeit zurück:
„Hier finden sich kleine und kleinste produktive Einheiten, häufig nur
eine Person, die sich zu Ad-hoc-Projekten organisieren und gegebenenfalls
nur für die Dauer eines bestimmten Vorhabens existieren.” (ebd., 46f.)
Diese zeitliche Unbestimmtheit und auch Unbegrenztheit der Arbeit präge
auch eine neue Form des Verhältnisses von Arbeit und Freizeit, sie seien
tendenziell nicht mehr zu trennen. Die radikalste Flexibilisierung der
Arbeitszeit dominiere diesen Typus, die Trennung zwischen Frei- und
Arbeitszeit wird aufgehoben, „in gewissem Sinn fällt Leben mit Arbeit in
eins” (ebd., 47).
An diesem Punkt geht Lazzarato über Barbrooks und
Camerons Geschichtsschreibung hinaus. Er wechselt von der Beschreibungs-
zur Erklärungsebene: Kommunikation spiele eben wegen dieser spezifischen
Form der Arbeitsorganisation eine zentrale Rolle im Leben einer
immateriellen Arbeiterin. Ihre Fähigkeit „eine soziale Kooperation zu
organisieren” (ebd., 46) gehöre nämlich unmittelbar zu ihren Tätigkeiten.
Um ‘Ad-hoc-Projeke’ zu ermöglichen, muß zwischen den in einem, wie
Lazzarato es nennt, „Bassin der immateriellen Arbeit” (ebd.) flottierenden
Individuen eine Kooperation hergestellt werden. Dies geschieht über
Kommunikation.
Lazzarato begründet anschaulich den Zwang zur
Kommunikation auch im konkreten Vollzug der Arbeit, also nicht nur in
ihrem Vor- und Umfeld. Der Charakter der immateriellen Arbeit als einer
die ganze Subjektivität der Arbeitenden einschließende Tätigkeit habe
weitreichende Folgen: „Wenn es nicht mehr länger möglich ist, der
Subjektivität bloß ausführende Tätigkeiten zuzuweisen, bedarf es
Vorkehrungen, ihre Fähigkeiten zur Planung und Leitung, zur
Kommunikativität und Kreativität den Bedingungen […] anzupassen” (ebd.,
42). Im Anschluß an diese Anforderungen laute daher die Devise: „Man muß
sich ausdrücken und sich äußern, man muß kommunizieren und kooperieren.”
(ebd., 43).
Wo Barbrook und Cameron wegen der Anlage ihres Artikels
lediglich den Siegeszug der ‘Kalifornischen Ideologie’ konstatieren und
rekonstruieren können (und zu Widerstand aufrufen), ergibt sich bei Negri
und Lazzarato aus der Verallgemeinerung zum Typus zumindest der Ansatz
einer These, um diesen Siegeszug zu erklären.
Lazzarato versteht die
neuen Formen der Produktion, in denen eben auch die Aufhebung der Trennung
in Frei- und Arbeitszeit, mithin völlig neue selbstbestimmte
Zeitstrukturen eine Rolle spielen, explizit nicht als lediglich funktional
„für eine neue Phase des Kapitalismus und die zugehörigen Akkumulations-
und Reproduktionsprozesse” (ebd., 51)40. Sie seien dies im Sinne einer
Rationalisierungsstrategie auch, aber gleichzeitig artikuliere sich hier
das Resultat einer ‘lautlosen Revolution’, die ganz unterschiedliche
Ebenen betreffe, etwa das ‘anthropologische’ Verständnis von Arbeit
selbst, „die Reartikulation ihrer Bedeutungen wie des mit dem Begriff
Bezeichneten.” (ebd.) Laut Toni Negri sei sogar ‘eine neue Ära’ erreicht
nach einer „lange[n] Phase von Arbeiterkämpfen und sozialen Kämpfen […],
die um die ‘Arbeitsverweigerung’ zentriert waren.” (Negri 1997, 136)
Automation und Computerisierung seien so zu interpretieren als die Antwort
‘des Kapitalismus’ auf diese ‘Verweigerung’. Dadurch sei auf der anderen
Seite jedoch ‘technowissenschaftliche’ (vgl. ebd., 143), also immaterielle
Arbeit immens, sowohl was ihre Bedeutung, als auch was ihre quantitative
Verbreitung angeht, aufgewertet worden: „Die tausend Varianten des
‘Toyotismus’ und ihr Erfolg überall auf der Welt reduzieren sich
schließlich auf die meist explizite Anerkennung der unmittelbar
wertsetzenden Funktion der Arbeitersubjektivität.” (ebd., 141)
Auch
Lazzarato wartet mit einer Prognose der z.T. schon erfolgten
Universalisierung der immateriellen Arbeit auf. Sie sei nämlich nicht
weiterhin auf einige Bereiche beschränkt, der Begriff spiele direkt
„auf die Veränderungen an, denen Arbeit in den großen Unternehmen
sowohl im ‘Produktions-’ als auch im ‘Dienstleistungs’-Sektor unterworfen
ist, wo die unmittelbaren Produktionsaufgaben immer mehr an Fähigkeiten
verlangen, mit Informationen umzugehen und eine horizontale und vertikale
Kommunikation einzubeziehen.” (Lazzarato 1998, 39)
Diesen neuen
Anforderungen an die Arbeitenden könne immer mehr nur derjenige gerecht
werden, der seine Subjektivität und Persönlichkeit einsetze (vgl. ebd.,
41). Denn die „Arbeitenden stehen unter Selbstkontrolle und
Selbstverantwortung inmitten ihres Teams, ohne daß ein Vorarbeiter
intervenieren müßte, wobei dieser wiederum in die neue Rolle des
Animateurs schlüpft.” (ebd., 44) Zumindest ein (wesentlicher) Teil der
Arbeitenden arbeitet also unter Bedingungen, die den idealtypischen zu
Beginn geschilderten der immateriellen Arbeit sich angleichen. Oder in den
Worten Negris:
„Diese ‘Intelligenzija’ bildet jedoch nicht eine neu
zusammengesetzte Avantgarde oder Führungsschicht, sondern sie ist vielmehr
eine Qualität und eine Subjektivität, die sich horizontal im Spektrum der
gesellschaftlichen Produktion und in den verschiedensten
Produktionssektoren ausdehnt.” (Negri 1997, 144)
3. ‘Wissensarbeiter’ und ‘Wissenswerker’
Negri und Lazzarato
stellen weitreichende Thesen auf. Sie behaupten, das sollte klar geworden
sein, letztlich eine Kongruenz zwischen neuen Rationalisierungsmodellen
und dem Kampf der Arbeitenden gegen alte Arrangements von Arbeit und
Leben.
Egon Guenther reibt sich in seiner Kritik des ‘fröhlichen
Operaismus’ vor allem an Negris optimistischen
Technikdeterminismus: „Drei Jahre vor dem ersten Weltkrieg schrieb der
Anarchist Gustav Landauer, dass der Marxismus eine Art moderne Magie sei,
bei der nicht mehr aus dem Kaffeesatz, sondern aus dem Dampf gelesen
werde: ’Der Vater des Marxismus ist der Dampf.’ […] Zwei Jahre vor der
Jahrtausendwende muesste Landauer sein Urteil nur geringfuegig abaendern.
Postmoderne Marxisten prophezeien nicht mehr aus dem Dampf. Sie lesen aus
der funktionalen Anordnung elektronischer Bauteilchen.” (Guenther
1998)
Tatsächlich ist ein Typus, wie er von Negri und Lazzarato
beschrieben wird, ohne die Rationalisierungspotentiale der neuen
Technologien, allen voran des Computers nicht denkbar. Dennoch scheint mir
ein allzu optimistischer Technikdeterminismus der ‘fröhlichen Operaisten’
nicht das Problem. Freilich ist es verdienstvoll, wie Guenther es tut,
immer wieder darauf hinzuweisen, „[…] dass die integrierten neuen
technologischen Formen wohl nicht ausschliesslich in den Garagen einer aus
dem Verwertungsprozess ausgetretenen Massenintelligenz zusammengebastelt
worden sind.” (ebd.) Das diese Erkenntnis berücksichtigende Bemühen Negris
und Lazzaratos, soziale Kämpfe mit Rationalisierungsstrategien
zusammenzudenken, also z.B. die Spannung zwischen dem Wunsch, das eigene
Leben selbst zu ‘zeiten’ und dem Zwang hierzu nicht vorschnell aufzulösen,
erscheint mir im Ansatz nicht problematisch, in der Umsetzung allerdings
zu undifferenziert. Dies wird v.a. dann zu einem Problem, wenn sie in der
Beschreibung der Kämpfe um Befreiung und ihrer Erfolge schwelgen. Das
Interesse für die andere Seite der Medaille, die neuen
Rationalisierungsstrategien und ihre Auswirkungen, die, in der
Industriesoziologie übereinstimmend als weitgehend im Fluß und daher
ungewiß beschrieben worden sind, wischen sie mit dem Hinweis auf die
‘tausend Varianten des Toyotismus’ hinweg.
Eine wichtige
Differenzierung gerade in bezug auf die für Negri und Lazzarato so
wichtigen Bereiche der zunehmend wissensgesteuerten Produktion führt
Hermann Kocyba ein. Er weist darauf hin, daß zwar wirklich vor allem im
Zuge der Einführung von Gruppenarbeit auch Fertigungsarbeiter zunehmend
„zu Wissen verkörpernden ‘Wissenspraktikern’” (Kocyba 1999, 100) würden.
Dies sei jedoch ein Phänomen, das ‘Wissensarbeiter’ von ‘Wissenswerkern’
scheide: „Das Wissen der Wissenswerker ist an konkrete Erfahrungen,
Gegebenheiten, Kontexte und Routinen gebunden.” (ebd.) Insofern werde es
für diese schwer sein, das Wissen, das mit neuen
Rationalisierungsstrategien an Bedeutung gewinnt, beispielsweise bei einem
Arbeitsplatzwechsel „mitzunehmen” und so zu einer ihnen eigenen Ressource
zu machen (vgl. ebd., 110f.). Die ‘Wissensarbeiter’ hingegen nutzten laut
Kocyba und ganz im Einklang mit Negris und Lazzaratos Beschreibung „Wissen
als ein völlig frei bewegliches Produktionsmittel” (ebd., 100).
Es
liegt nahe, daß bei Negri und Lazzarato neue ‘Wissensarbeiter’, diese vor
allem in speziellen Sektoren (Werbung, Software, usw.) als ungemein
rationalisierend wirkende Kaste auf der einen, und ‘Wissenswerker’ auf der
anderen Seite verwechselt werden.
Differenziert man Kocyba folgend
beide Typen, so bleibt die Beschreibung des Stellenwerts der Mediennutzung
in einem nachfordistischen Arrangement zwischen Arbeit und Leben, wie sie
Negri und Lazzarato vorgelegt haben, zumindest für die ‘Wissensarbeiter’
weiter aktuell. Teile ihrer historisch-theoretischen Herleitung sind
jedoch zu modifizieren. Was hierzu nötig ist, ist eine auf neue Formen der
Mediennutzung bezugnehmende Konzeptualisierung der ‘Wissensarbeit’. Ich
glaube sie in den Thesen der AG KAIROS gefunden zu haben.
4. ‘Wissensarbeit’ im Informationsraum (AG KAIROS)
Der Ausgangspunkt der
Arbeitsgruppe KAIROS am Institut für Soziologie der Technischen Hochschule
Darmstadt ist eine Begrifflichkeit, die eine ähnlich prominente Rolle wie
der Begriff der „immateriellen/mentalen Arbeit” bei Negri/Lazzarato hat,
es ist die der „Informationsarbeit” bzw. der
„Informatisierung”.
Informationsarbeit
Nicht die kreativen, künstlerisch-kulturellen
Aktivitäten, wie bei Lazzarato bilden das Modell für diese Form der
Arbeit, sondern die Tätigkeiten der „Ingenieure als typische
‘Wissensverarbeiter’” (Baukrowitz/Boes 1996, 133). Diese seien zu Beginn
des Jahrhunderts erstmals in der US-amerikanischen Automobilindustrie
eingesetzt worden. Ihre Tätigkeiten sind nicht mehr unmittelbar auf die
Produktion bezogen, sondern auf „deren Widerspiegelung in Form von
Informationen und Ideen” (ebd.). Später seien zwei andere „Typen leitender
Informationsarbeit” (ebd.) hinzugetreten, die Finanzmanager und die
Marketing-Spezialisten. Gerade sie hätten keinerlei Kenntnisse der
konkreten Produktionsvorgänge und prozessierten lediglich Informationen in
der Form von Zahlen (vgl. ebd.).
Damit ist die zentrale Aufgabe
informatisierter Arbeit beschrieben, wie sie von der AG KAIROS verstanden
wird. Es geht um Arbeit am „Informationsproblem”, das heißt, „daß man sich
vornehmlich mit der Selektion von Information, ihrer formalisierten
Bearbeitung und ihrer störungsfreien Übertragung befaßt.” (Baukrowitz
1996, 70)
Anderea Baukrowitz und Andreas Boes stellen zwar analog zu
Negri und Lazzarato fest: „Die Bedeutung der Informationsarbeit wird
weiter zunehmen. Dies gilt in quantitativer Hinsicht sowohl für die
Ausdehnung der Beschäftigtengruppen, die ausschließlich mit der
Verarbeitung von Informationen befaßt sind, als auch für den Anteil der
Informationsarbeit an der Arbeit aller Beschäftigtengruppen. Und dies gilt
in qualitativer Hinsicht; je wirkungsvoller sich die Produktionsprozesse
über die informatorische Ebene steuern lassen, desto mehr wird die
Informationsarbeit an Bedeutung gegenüber der Arbeit auf der
stofflich-energetischen Ebene des Produktionsprozesses gewinnen.”
(Baukrowitz/Boes 1996, 145)
Gleichzeitig werde der reflexive Anteil der
Arbeit größer, die Scheidung zwischen Arbeit auf der einen Seite und deren
Innovierung nach Kriterien der Effizienz und Qualität des ganzen
Kooperationszusammenhangs auf der anderen Seite falle tendenziell (vgl.
ebd.).
Allerdings ist dies für Rudi Schmiede keineswegs Grund für
Optimismus. Informationsarbeit sei nämlich von Anbeginn an mit einer
Spaltung der Arbeitendenschaft verbunden. Um dies zu zeigen, setzt er ein
bei der Klärung des Begriffs Information: „Informationen sind die auf die
Manipulation der Sachverhalte gerichtete Formveränderung gedanklicher
Inhalte, die generelles Charakteristikum und Ergebnis der Durchsetzung
formaler Rationalität ist.” (Schmiede 1996b, 20) Ohne den Einsatz von so
verstandener Information zur Organisation der kapitalistischen
Produktionsweise sei eine weitere Akkumulation des Kapitals im 20.
Jahrhundert nicht möglich gewesen (vgl. ebd., 21). Taylors wichtigste
Innovation sei keineswegs die Zerlegung der Arbeit in repetetive
Teilelemente gewesen, sondern die Trennung in Wissen und durch dieses
Wissen kontrollierte ausführende Arbeit (vgl. ebd., 22). Gleichzeitig habe
sich jedoch auch aus der zunehmenden Maschinisierung der
Produktionsabläufe und der Technisierung der Verteilungsvorgänge unter der
Bedingung sich immer mehr beschleunigender Abläufe ein massives Kontroll-
und Steuerungsproblem ergeben, das bereits eingeführte Informationsproblem
(vgl. ebd., 23). Zunächst heterogen erscheinende technische Innovationen,
der Ausbau des Eisenbahnnetzes, der Telegraph und der Aufbau von
betriebsbürokratischen „Zettelsystemen” seien technische Reaktionen, um
dieses Kontrollproblem in den Griff zu bekommen (vgl. ebd.,
24).
Entqualifizierung und
Dequalifizierung
Die Folge der vor allem durch den massenhaften Einsatz
von Computern verkörperten „neuen Qualität der informationsverarbeitenden
Maschinen” (ebd., 36) sei die allgemeine Entqualifizierung der Arbeit.
Diese sei nicht mit Dequalifizierung, der sich auch in der Entlohnung
niederschlagenden Entwertung der Tätigkeiten zu verwechseln sei. Gemeint
ist vielmehr, daß die Qualität des Arbeitsprozesses hinter abstrakten
Eingabemasken verloren geht (vgl. ebd., 44f.).
Verbinden wir dies mit
den von ihm im gleichen Band referierten empirischen Befunden zur
Informationsarbeit, so lassen sich die bei Negri und Lazzarato vermißten
Differenzierungen einführen. Es sei davon auszugehen, daß gerade
diejenigen, deren Arbeit am meisten durch Informatisierungsphänomene
geprägt seien, das höchste Qualifikationsniveau ausweisen dürften, denn
man könne „den denkerischen Vollzug der Algorithmisierung nur in eine[m]
längere[n] Qualifizierungsprozeß” (Schmiede 1996b, 45) erlernen. Diese
zwar von Ent-, aber nicht von Dequalifizierung betroffenen
Informationsarbeiter wären wohl am ehesten zu verorten in der „Gruppe der
minoritäre[n] Gruppe von entfremdeten high-tech-Arbeitskräften, deren
Existenz durch high-tech-stress und Überarbeit charakterisiert ist”
(Schmiede 1996c, 116). Ihre Beschäftigung sei nichtsdestotrotz stets
prekär. Schmiede weist darauf hin, daß gerade im Informationssektor eine
wachsende Anzahl von statistisch schwer erfaßbaren Selbständigen und
Scheinselbständigen zu finden seien (vgl. ebd., 117).
So deute sich im
Sektor der sich ausbreitenden Informationsarbeit eine Polarisierung im
nationalen und internationalem Maßstab an, die sich Schmiede nach der
Schilderung der US-amerikanischen Verhältnisse durch Jeremy Rifkin (1995)
vorstellt. Die hochqualifizierten Wissensarbeiter, die die neue
High-Tech-Wirtschaft steuerten und die etwa vier Prozent der abhängig
Erwerbstätigen ausmachten und eine weitere Gruppe von 16 Prozent, „die
ebenfalls vor allem mit Hilfe ihrer intellektuellen Fähigkeiten viel Geld
verdienen” (ebd., 120), beide zusammen seien die Katalysatoren” der
Informationsgesellschaft und ihre Gewinner (vgl. ebd.). Eine Mehrheit von
80 Prozent jedoch gehöre zur Gruppe der Verlierer, „hier findet sich auch
die große und wachsende Gruppe der Unter- und Schlechtbeschäftigten”
(ebd., 121).
Indem Negri und Lazzarato ‘Wissenswerker’ und
‘Wissensarbeiter’ nicht differenzieren, kommen ihnen wesentliche
Cahrakteristika des von ihnen beschriebenen Typus nicht in den Blick. Noch
einmal auf Hermann Kocybas Unterscheidung der beiden wissensbasierten
Tätigkeiten zurückgreifend ist zu vermuten, daß gerade die hochgradige
Abstraktifizierung der Tätigkeiten des ‘Wissensarbeiters’, deren
hochqualifizierte Entqualifizierung, dessen relative Privilegiertheit
begründet. Als Spezialisten in Sachen Informationsproblem sind sie mit der
nach der AG KAIROS immer größer werdenden Bedeutung dieser Fähigkeit,
tatsächlich immer stärker von traditionellen Arbeits- und
Produktionsstrukturen unabhängig. Doch die Thesen der AG KAIROS gehen
weiter. Der Begriff des Informationsraums spezifiziert Lazzaratos Metapher
des ‘Bassins der immateriellen Arbeit’ für die hochqualifizierten
Informationsarbeiter des Computerzeitalters.
Eintritt in den
Informationsraum
Im nach dem tayloristischen Paradigma gestalteten
Unternehmen gehe es zunächst nur um die Steuerung automatisierter
Vorgänge, die Informationserzeugung selbst funktioniere nach
mechanistischen Konzepten. Einmal geschehen, sei das Ergebnis der
Informatisierung für längere Zeit festgeschrieben. Das Informationsproblem
stelle sich demgegenüber in nachtayloristischen Produktionskonzepten, als
deren Prototyp Baukrowitz und Boes das der „systemischen Rationalisierung”
(vgl. Baukrowitz/Boes 1996, 138-14241) fassen, aufgrund neuer
Komplexitäten verschärft: „Handlungsvariationen und ihre positive wie
negative Bestätigung werden unmittelbar verknüpft und zeitnah für die
formalen Strukturen des Informationssystems und der (kollektiven)
Bedeutungszuweisung ausgewertet.” (Baukrowitz 1996, 71)
Dies führe zu
einer neuen Qualität und Bedeutung der Informationsarbeit, eine neue Stufe
der ‘Wissensarbeit’ sei erreicht. Andrea Baukrowitz entwickelt für diese
Stufe das Modell einer Arbeit, die nicht mehr nur aus der Aggregation,
Selektion und Analyse von Information besteht, das war auch schon die
Aufgabe der Ingenieure, Finanzmanager und der Marketing-Spezialisten. Neue
Rationalisierungsstrategien erreichten derart neue Qualitäten von
Flexibilität und Offenheit, daß sie nur noch mittels „Informationsräume[n]
mit ihren offenen Verweisstrukturen” (Baukrowitz 1996, 74) bearbeitbar und
kontrollierbar seien. In der Verbindung von Telekommunikation und
Informatik vor allem im Internet werde ein derartiger Informationsraum
real greifbar (vgl. ebd., 66, 76).
Nur über Informationsräume werde es
also möglich, ungemein zeitnah (Ziel: Echtzeit) neue Rahmenbedingungen,
etwa neue Marktbedürfnisse in die eigene Informationsverarbeitung als eine
alle anderen Elemente beeinflussende Variable einzubetten. Der
Informationsraum sei jedoch gleichzeitig weit mehr als ein Werkzeug, indem
in ihm auch „zunehmend alle lebensweltlichen Bereiche in ihren
Informationsformen und -prozessen” (Baukrowitz 1996, 74) erfaßt würden.
Arbeit im Informationsraum ist also ohne ein mehr oder minder partielles
„Eintreten” in den Informationsraum nicht denkbar.
Für die im
Informationsraum Beschäftigten ergebe sich so neben der Selektion,
Formalisierung und Übertragung von Information eine weitere übergreifende
Aufgabe, nämlich die flexible (Re)Konfiguration von Produktionsprozessen,
in deren informationsräumlichem Elementen „traditionelle
Raum-Zeit-Strukturen überwunden und informatorisch neu geordnet werden”
(ebd., 74). Dies betreffe weitergehend schließlich das gesamte sozialem
Handeln (vgl. ebd.).
Das Internet in seiner Gestalt als Netz
unterschiedlichster altbekannter Kommuniaktions- und Informationsmedien
(Schlagwort: „Multi-Media“), das aber gleichzeitig auch ein Netz
informationsverarbeitender Maschinen (vulgo: Computer) ist, muß als
ideales Werkzeug einer derartigen Reorganisation der Produktionsprozesse
erscheinen.
Rudi Schmiede benennt die Bedingungen dieser für
hochqualifizierte Wissensarbeiter zunehmend zur Pflicht werdenden
Hereinnahme auch der lebensweltlichen Bezüge in den
Informationsraum: „Gerade weil das arbeitende Individuum kein
Zahnrädchen im großen Getriebe ist, sich aber in vielen Dimensionen [durch
die Anforderungen der Logik der formalen Systeme, TB] genauso zu verhalten
gezwungen findet, muß es subjektive Strategien der Bewältigung dieser
Situation entwickeln.” (Schmiede 1996b, 45)
Genau hier verläuft die
Trennlinie zwischen Gewinnern und Verlierern. Denn die hochqualifizierten
Informationsraumarbeiter gehorchen den Anforderungen der neuen Stufe der
Informatisierung von Arbeit und Produktion auf eine andere Art als die
Verlierer. Gar nicht so unähnlich dem Adornoschen Typus des ‚patenten
Kerls’ (vgl. Adorno 1938, 348) bewegen sie sich wie die Fische im Wasser
des Informationsraums und erleben sich als Souveräne ihres Königreichs,
das sie aktiv mit(zu)gestalten (glauben). Nur durch eine extrem enge
Verbindung mit dem Informationsraum sind sie in der Lage, sich so in ihm
zu bewegen. Diese weitgehende Fähigkeit zur Immersion in den
Informationsraum tragen sie in der Tat gleichsam mit sich, ebenso wie der
Informationsraum, dessen materielles Substrat in den elektronischen Netzen
aufscheint, die ursprünglichen Einheiten der Produktion (Fabrik)
transzendiert. Ihre diesbezügliche Qualifikation macht sie wertvoll für
die neuen Formen der Rationalisierung betrieblicher Vorgänge und
unabhängig von den (Wissens)Kontexten ihres je spezifischen
Arbeitsumfelds. Herrmann Kocybas Unterscheidung von ‚Wissenswerkern‘ und
‚Wissensarbeitern‘ findet eine weitere Bestimmung.
Anders als bei Negri
und Lazzarato ist also mit den Informationsraumarbeitenden ein Segment
beschrieben, das bezogen auf den globalen Trend der zunehmenden
Wissensbasiertheit gesellschaftlicher Produktion Gemeinsames mit und
Trennendes gegenüber den anderen Beschäftigten aufweist. Gemeinsam ist
ihnen der zunehmende Grad der Entqualifizierung, den die um sich greifende
Abstraktifizierung der Tätigkeiten bringt, es trennt sie aber der Grad der
Dequalifizierung, wie er sich vor allem an den unterschiedlichen
Arbeitsbedingungen zeigt.
5.Die Zukunft
der Arbeit
Die eingangs behaupteten
heute beobachtbaren Differenzierungen in den Nutzungsweisen des Internet
verlaufen genau entlang der Nähe bzw. Ferne zu einer
informationsräumlichen Auffassung des Internet. Um es auf einen Nenner zu
bringen: Je mehr die beobachtbaren Nutzungsweisen des Internet den
Nutzungsweisen herkömmlicher Medien ähneln, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, daß die Nutzenden weiblich, alt, nicht zur ethnischen
Majorität gehören oder/und formal gering gebildet sind. Eine
raum-zeitliche Integration der unterschiedlichen über das Internet
möglichen Kommunikations- und Informationsweisen, die weitgehende
Vermischung von Arbeit und Leben in der Internetnutzung, nicht zuletzt die
Qualifikation, gestaltend einzugreifen, also z.B. (Internet-)Applikationen
zu Programmieren, all dies ist Kennzeichen der Informationsraumarbeiter.
Diese jungen, hochqualifizierten, weißen Männer waren von je her die
Kerngruppe der Internetnutzendenschaft und sind die Gewinner des
Internetbooms der 90er Jahre. Das normative Inventar der antifordistischen
Rebellion der 60er Jahre tragen sie von Anbeginn an im Tornister, das habe
ich bei Barbrook und Cameron gelernt.
Derzeit weist viel darauf hin,
daß wir von dieser Gruppe noch sehr viel mehr hören werden. Daß sie sich
verallgemeinert, halte ich für unwahrscheinlich, wie mehrfach
angesprochen vermute ich, daß Negri und Lazzarato unterschiedliche
Formen der wissensbasierten Arbeit verwechseln. Als weitgehendste
Konsequenz des hier dargestellten ist; allerdings vorstellbar, daß
die Informationsraumarbeitenden als hegemoniale Norm den weißen
Familienernährer des klassischen Fordismus verdrängen. An dieser Norm
würden dann alle anderen Formen des Lebens und Arbeitens gemessen, und im
Fall des Falles als defizitär gebrandmarkt. Damit zeichnete sich mit dem
lang erwarteten „Neuen Medium“ endlich auch die lang erwartete
nachfordistische Ordnung ab.
Literatur:
Adorno (1938):
Adorno,
T.W.: Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des
Hörens. In: Zeitschrift für Sozialforschung. VII/3. S.321-356.
Barbrook/Cameron
(1997):
Barbrook, R./Cameron, A.: Die kalifornische Ideologie. In:
nettime (1997): S.15-36.
Baukrowitz
(1996):
Baukrowitz, A.: Neue Produktionsmethoden mit alten
EDV-Konzepten? Zu den Eigenschaften moderner Informations- und
Kommunikationssysteme jenseits des Automatisierungsparadigmas. In:
Schmiede (1996a), S.49-77.
Baukrowitz/Boes
(1996):
Baukrowitz, A./Boes, A.: Arbeit in der
„Informationsgesellschaft”. Einige Überlegungen aus einer (fast schon)
ungewohnten Perspektive. In: Schmiede (1996a), S.129-157.
Guenther
(1998):
Guenther, E.: Kommunismus für Eliten. Antonio Negris fröhlicher
Operaismus. In: 4. Hilfe. Als Online-Quelle, URL:
http://www.art-bag.net/hilfe/Hilfe4/negri.htm
[1.8.99]
Hanke/Becker
(1998):
Hanke, T./Becker, H.: „Ich habe schon 20 Megabyte
Antifaschismus geschrieben …”. Zur Praxis linker Projekte in
Computernetzen. In: Alaska. H.218, 2/98. S.12-16.
Kocyba (1999):
Kocyba,
H.: Wissensbasierte Selbststeuerung: Die Wissensgesellschaft als
arbeitspolitisches Kontrollszenario. In: Konrad, W./Schumm, W. (Hg.):
Wissen und Arbeit. Münster. S.92-119.
Lazzarato
(1998):
Lazzarato, M.: Immaterielle Arbeit. Gesellschaftliche Tätigkeit
unter den Bedingungen des Postfordismus. In: Negri/Lazzarato/Virno (1998),
S.39-52.
Negri (1996b):
Verlangt
das Unmögliche, mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Interview mit
Toni Negri. In: Die Beute. Politik und Verbrechen. Winter 1996. Berlin.
S.92-106.
Negri (1997):
Negri,
T.: Die Arbeit des Dionysos. Materialistische Staatskritik in der
Postmoderne. Berlin.
Negri/Lazzarato/Virno
(1998):
Negri, T./Lazzarato, M./Virno, P.: Umherschweifende
Produzenten. Immaterielle Arbeit und Subversion. Berlin.
nettime (1997):
nettime
(Hg.): Netzkritik. Materialien zur Internet-Debatte. Berlin.
Rifkin (1995):
Rifkin,
J.: Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft. Frankfurt/New York.
Schmiede
(1996a):
Schmiede, R. (Hg.): Virtuelle Arbeitswelten. Arbeit,
Produktion und Subjekt in der „Informationsgesellschaft”.
Berlin.
Schmiede
(1996b):
Schmiede, R.: Informatisierung, Formalisierung und
kapitalistische Produktionsweise. Entstehung der Informationstechnik und
Wandel der gesellschaftlichen Arbeit. In: Schmiede (1996a),
S.15-47.
Schmiede
(1996c):
Schmiede, R.: Informatisierung und gesellschaftliche Arbeit.
Strukturveränderungen von Arbeit und Gesellschaft. In: Schmiede (1996a),
S.107-128.